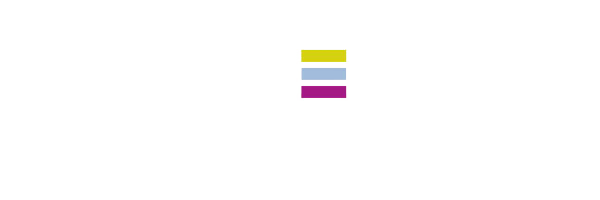Rebecca absolviert ein voll finanziertes Doktorat an der Universität Glasgow in der Fakultät für Englische Literatur (der Co-Betreuer ist spezialisiert auf Schottische Literatur) und befindet sich derzeit im ersten Studienjahr. In ihrer Doktorarbeit untersucht sie anhand einer kritischen Analyse fiktionaler Romane, wie die Deindustrialisierung die literarische Bildsprache beeinflusst hat. Sie untersucht eine Vielzahl von Werken, die seit 1980 veröffentlicht wurden. Im Jahr 2020 schloss Rebecca ihr Studium an der Universität von Newcastle ab, wo sie einen Bachelor mit Auszeichnung (First Class Honours) in den Fächern Englische Literatur, Geschichte und Politik erhielt. Im Rahmen dieses Bachelor-Studiengangs reichte sie eine Abschlussarbeit ein, in der sie die Auswirkungen der Schließung des Stahlwerks in Consett, County Durham, im Jahr 1980 auf die Gemeinde und die Reaktionen darauf untersuchte. Rebecca verfolgte in ihrem Master-Studiengang in Englischer Literatur, ebenfalls in Newcastle, einen interdisziplinären Ansatz zur Untersuchung der Deindustrialisierung und schloss ebenfalls mit Auszeichnung ab. In ihrer Abschlussarbeit setzte sie sich mit dem kulturellen Erbe der Deindustrialisierung in der fiktionalen Literatur Nordostenglands auseinander. Im Großen und Ganzen umfassen ihre Forschungsinteressen kritische und literarische Theorie, Deindustrialisierungsstudien, Ungleichheiten im Gesundheitswesen und regionale Ungleichheiten.
Forschungserklärung: Class, Health and Region: Narratives of Social Trauma in English and Scottish Regional Fiction since Thatcher
Mein Promotionsprojekt baut auf meiner bisherigen Arbeit zur Deindustrialisierung in der fiktionalen Literatur auf. Mit meinen bisherigen Arbeiten habe ich mir einen soliden theoretischen Rahmen erarbeitet. Nun erweitere ich meine Analyse über den Schwerpunkt Nordostengland hinaus und dehne sie auf Regionen jenseits der Grenze aus, nämlich auf das Schottische Zentralgebiet. Entscheidend für meine Arbeit ist die Prämisse, dass die Deindustrialisierung ein anhaltender Prozess ist, der Regionen und lokale Communitys auch heutzutage noch schadet und einschränkt. Dieser Prozess wird durch Sparmaßnahmen und kapitalistische Krisen, die bis heute andauern, weiter verschärft. Angesichts des Ausmaßes und der Geschwindigkeit, mit der die Deindustrialisierung in Großbritannien erfolgte, bestätigt meine Forschung die Behauptungen vieler Deindustrialisierungsforscher:innen: Sie muss als sozialer Prozess verstanden werden, der traumatisierende Auswirkungen auf die Menschen hat.
Der Forschungskorpus meiner Untersuchung umfasst zahlreiche fiktionale Romane von 1980 bis heute – zum Beispiel James Kelmans 1994 erschienener Bewusstseinsstrom-Roman „How Late it Was, How Late“ bis hin zu Ely Percys zeitgenössischer Coming-of-Age-Geschichte „Duck Feet“ (2021). Auch wenn die Deindustrialisierung in meinen Primärtexten nicht immer explizit erwähnt wird, zeigt meine Forschungsarbeit, dass die „Halbwertszeit der Deindustrialisierung“, um es mit Sherry-Lee Linkon zu sagen, immer vorhanden ist – sei es durch Berichte über Arbeitslosigkeit, Armut, Umweltzerstörung oder schlechte Gesundheit. Aus diesem Grund erweist sich der fiktionale Roman langfristig als wichtiger Schlüssel zum Verständnis der Deindustrialisierung. Die Durchführung einer literarischen Analyse kann uns bei der Beantwortung vieler entscheidender Fragen zum Niedergang der Schwerindustrie helfen, wie z. B.: Was vermitteln fiktionale Erzählungen über die Erfahrung der Deindustrialisierung, und ändern sich diese Erzählungen je nach Zeitpunkt oder Ort der Veröffentlichung? Wie verarbeiten proletarische Schriftsteller:innen aus deindustrialisierten Regionen in Romanen soziale/individuelle Traumata, die durch den Niedergang der Industrie verursacht wurden? Was können uns fiktionale Romane darüber erzählen, wie die Gesellschaft die Deindustrialisierung in Erinnerung behält, und was sagt dies über die „postindustrielle“ Gegenwart aus?